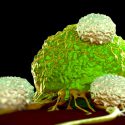Politiker in Russland und in der EU werden einer Zivilgesellschaft neuen Typs Gehör schenken müssen
Vor zehn Jahren, im Herbst 2009, hatte die Beziehung zwischen Russland und der Europäischen Union (EU) eine Perspektive. Präsident Dmitri Medwedew hatte gerade seinen Artikel „Russland, vorwärts!“ veröffentlicht. Er enthielt eine weitreichende Kritik am Zustand des Landes und den Aufruf zur Modernisierung und wurde allseits diskutiert. Ein Jahr nach dem Konflikt in Südossetien war es zu einer grundlegenden Entspannung der Lage gekommen, der amerikanische Begriff des Relaunchs – oder Neustarts – ließ auf eine neue Etappe der Beziehungen zwischen Russland und dem Westen hoffen.
Die EU zeigte ebenfalls freudige Erwartung. Die Krise im Zusammenhang mit dem vier Jahre zurückliegenden Scheitern der Verfassung für Europa war überwunden, die Unterzeichnung einer abgespeckten Version in Gestalt des Lissabon-Vertrags wurde vorbereitet.
Kurz gesagt, der Himmel hellte sich auf.
Ich erwartete große Veränderungen und sagte damals in einem Seminar über die Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union in Berlin, es sei unmöglich, die Zukunft vorherzusagen. Es sei unklar, wie es um alle Akteure einschließlich der EU nach fünf Jahren stehen werde. Meine Zuhörer, hochrangige und kompetente Vertreter der politischen und intellektuellen Elite, begannen zu lachen und gaben zu verstehen, was sie meinten: Das ist bei euch in Russland so, dass nie etwas klar ist, in der EU dagegen lässt sich alles ziemlich exakt vorhersagen. In fünf Jahren, in zehn Jahren werde alles genau so sein, nur besser.
Einige Monate danach begann für die EU eine lange Zeit der Krisen: Auf die Schuldenkrise folgten die Migrationswelle, der Ukraine-Konflikt, das Referendum in Großbritannien und die rasante Erosion der politischen Kräftekonstellation in den führenden EU-Staaten bei gleichzeitigen unerwarteten Manövern des transatlantischen Schutzpatrons. Die schnelle Aufeinanderfolge der Ereignisse zeigte eindeutig, dass es sich nicht um ein zufälliges Versagen, sondern um ein systemisches Problem handelt.
Auch Russland hat seitdem seinen Ruf als Land der ständigen „kreativen Unruhe“ bestätigt. Die politischen Erwartungen der „Ära der Modernisierung“ wurden von einer anderen Wirklichkeit abgelöst, und die Ukraine- Krise wurde zu ihrem Katalysator, aber sie war nicht die Ursache. Der harte Konflikt mit dem Westen erwies sich als Kulminationspunkt seit langem reifender konzeptioneller Gegensätze, die schon mit dem Ende des Kalten Kriegs angelegt worden waren.
Gegenwärtig dominiert in den Beziehungen zwischen Russland und der EU die Wachsamkeit. Das ist zugleich schlecht und gut. Schlecht deshalb, weil das Vertrauen in der zurückliegenden Zeit stark erschüttert wurde, vor allem infolge der enttäuschten Erwartungen. Gut deshalb, weil eben diese unerfüllten Erwartungen zu einer spürbaren Ernüchterung geführt haben, und die Seiten nunmehr wesentlich besser verstehen, was möglich ist und was Fantasien sind.
Die vor 30 Jahren proklamierte Ära der Errichtung eines „gesamteuropäischen Hauses“ ist endgültig abgeschlossen, was jedoch nicht bedeutet, dass diese Baustelle jetzt dem Unkraut preisgegeben ist. Wie sich das Geschehen in der Welt auch entwickeln mag, das Wechselwirken im Rahmen des geografischen Europas wird und muss weitergehen.
Konnte man vor zehn Jahren die Veränderungen anhand von Empfindungen und Vorahnungen prognostizieren, so sind sie nunmehr durch sichtbare Prämissen determiniert. Die europäische Integration nach dem Modell der diesbezüglich erfolgreichen zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und des „Upgrades“ nach dem Kalten Krieg funktionierte nicht mehr.
Dafür gibt es viele Gründe, vor allem die tiefgreifenden Veränderungen des internationalen Kontexts. Über einen weiteren Umstand wird zwar viel geredet, aber es gibt noch keine Antwort. Es geht um die Demokratie und den Entscheidungsprozess.
Es ist kein Geheimnis, dass die zu Beginn der 1950er-Jahre in Gang gesetzte europäische Integration kein wirklich demokratischer Prozess war. Das ist auch nicht verwunderlich. Es ist nicht vorstellbar, dass die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, also der Zusammenschluss der Aufsicht über strategische Industrien Frankreichs und Deutschlands, zustande gekommen wäre, wenn man diese Idee 1951, also sechs Jahre nach der blutigsten Auseinandersetzung in der Geschichte der Beziehungen zwischen diesen beiden Staaten, in einem Referendum zur Abstimmung gestellt hätte.
Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts blieb der Integrationsprozess eine höchst elitäre Angelegenheit, die Entscheidungen wurden von den politischen und wirtschaftlichen Spitzen auf der Grundlage kalkulierter Interessen und Expertenmeinungen getroffen. Die wichtigste Voraussetzung bestand jedoch darin, dass sie es stets vermochten, dem einfachen Europäer nahezubringen, dass diese oder jene Entscheidung für ihn persönlich vorteilhaft sei.
Im 21. Jahrhundert hat sich diese Situation verändert. Die zunehmend komplizierte Integration in einer gewachsenen EU machte es fast unmöglich, den Sinn der immer ausgeklügelteren rechtlichen und bürokratischen Festlegungen verständlich darzulegen, die für die Verwaltung und Entwicklung der EU notwendig waren. Der letzte verständliche Schritt war wohl die Einführung der einheitlichen Währung, des Euro.
Später ging es dann um völlig verworrene Themen. Den 800- seitigen Wortlaut der Europäischen Verfassung, eines komplizierten juristischen Dokuments, konnte fast niemand von jenen erfassen, die darüber abstimmen sollten. Das gilt auch für andere Angelegenheiten, sowohl praktischer als auch abstrakter, wertbezogener Natur, die nach Auffassung der politischen Klasse notwendig sind, den Wählern jedoch immer weniger vermittelt werden können.
Dort ist allerdings ein erstaunliches und seltsames Phänomen zu beobachten. Gerade in dieser Etappe der gleichzeitigen Vertiefung und Ausweitung der Integration wollte man sich immer häufiger der Stimme des Volkes zuwenden. Das hing damit zusammen, dass die Widersprüche innerhalb der Eliten und zwischen ihnen zugenommen hatten, dass die Interessen nur mit immer deutlicherem Zähneknirschen zusammengeführt werden konnten. Deshalb wurden Plebiszite nicht nur als eine Möglichkeit zur Legitimierung dieser oder jener Entscheidungen gesehen, sondern sogar als Möglichkeit zur Klärung der Beziehungen und als politisches Instrument. Das deutlichste Beispiel mit katastrophalen Folgen ist die Abstimmung über den Verbleib in der EU in Großbritannien.
Dadurch hat die Volksmeinung in den gesamteuropäischen Angelegenheiten an Gewicht gewonnen, und die Oberschichten der Gesellschaft haben anstelle der früheren Erläuterung und Aufklärung den Informations- und Propagandaknüppel hervorgeholt, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Daraus verstärkte sich bei den Menschen das Gefühl, ihnen solle etwas untergeschoben werden, was anderen nützt.
So wurde die Entfremdung der Oberen von der Basis auf eklatante Weise augenscheinlich. Sie findet ihren Ausdruck im berüchtigten Populismus, der übrigens zu einer Waffe nicht nur der ehemaligen Randgruppen, sondern auch des seine Selbstsicherheit einbüßenden Mainstreams geworden ist.
Mittels der „sozialen Medien“ haben wesentlich breitere Massen eine Stimme erhalten als beim früheren Mediensystem, das hinreichend effizient gesteuert werden konnte. Auf diese Weise sind die politischen Prozesse deutlich demokratischer geworden, doch die europäische Integration war darauf nicht eingestellt. Die Versuche zur Anpassung der europäischen Institute, die ihnen einen transparenteren und demokratischeren Charakter verleihen sollen, zeigen bisher eher einen gegenteiligen Effekt.
Nach den Wahlen zum Europaparlament ist es zu einer bösen Blamage gekommen, als das System der Spitzenkandidaten der gesamteuropäischen Parteien im Papierkorb landete, während der engere Kreis des Führungspersonals die Posten auskungelte. Das hat das Problem der Entfremdung zwischen Eliten und Volk nicht gelöst, sondern eher noch verstärkt.
Dort tritt ein Schlüsselproblem offen zutage. Es geht um die Gestaltung einer neuen Balance zwischen Macht und Gesellschaft, Nationalem und Gesamteuropäischem, Werteorientiertem und Pragmatischem. Solange diese Balance nicht gefunden wird, bleiben alle anderen Fragen zweitrangig, einschließlich der Beziehungen zu Russland. Bevor dieser Prozess nicht abgeschlossen ist, bevor keine neuen Fundamente entwickelt sind, fehlen Europa Energie und Ressourcen, um sich aktiv um die adäquate Positionierung in der Welt zu bemühen.
Ein völlig anderes, jedoch nicht weniger dringendes Problem hat Russland. Die Legitimität der Macht im Sinne ihrer Fähigkeit, die Entwicklung des Staats, der Gesellschaft und jedes konkreten Individuums zu gewährleisten, wird zur entscheidenden Bedingung für Stabilität und Prosperität. Die Einbeziehung breiterer Massen in die Kommunikation hat Auswirkungen auf das Vertrauen zur Führungsspitze. Lebensniveau und Lebensqualität bewegen die Bürger mehr als außenpolitische und geopolitische Themen.
Zwar ist die noch in den 1990er-Jahren formulierte Agenda erfüllt, Russland ist als Akteur der ersten Liga in die Weltarena zurückgekehrt. Das löst zwar bei der Bevölkerung Genugtuung aus, hebt jedoch die anderen Fragen nicht auf.
Anders gesagt: in den gegenseitigen Beziehungen bewegen sich Russland und die EU wie zwei Introvertierte, was eine besondere Art der Kommunikation hervorbringt, die durch Zurückhaltung und Vorsicht geprägt ist. Die Romantiker erinnern unverdrossen daran, wie viele Gemeinsamkeiten beide Seiten haben und um wie viel leichter sie es hätten, auf viele Herausforderungen zu reagieren, wenn sie ihre Anstrengungen vereinigen würden.
In der Theorie stimmt das, in der Praxis sind die Umstände anders:
Erstens ist es bis zur Wiederherstellung des Vertrauens noch weit.
Zweitens haben Russland und die EU eigene Prioritäten. Bei Russland sind das Eurasien und die Beziehungen zu China, bei der EU die euroatlantischen Beziehungen zu den USA, die sich aber gerade sich selbst zuwenden.
Drittens, die Unsicherheit in Bezug auf die Architektur der Weltordnung in den nächsten Jahrzehnten zwingt alle Beteiligten zu höchster Achtsamkeit in verpflichtenden Partnerschaften. Handlungsfreiheit ist heute nötiger als je zuvor.
Und schließlich die Übergangssituation der EU: Eine Föderation ist nicht zustande gekommen, einzelne Staaten haben ihre frühere Bedeutung eingebüßt und werden zu Hindernissen.
Auf Unionsebene wird die Notwendigkeit, einen Grundkonsens erzielen zu müssen, viele Komplikationen erzeugen, ebenso in den Ländern, da deren Optionen für eine eigenständige Politik gegenüber dritten Partnern beschränkt sind.
Die politischen Aussichten sind also nicht die hoffnungsvollsten. In diesen Fällen wird gewöhnlich die Notwendigkeit betont, die Rolle der Zivilgesellschaft zu stärken. Das ist ein Allerweltsratschlag. Doch diesmal ist er genau richtig, weil die Gesellschaften in Anbetracht der skizzierten Gründe begonnen haben, eine größere Rolle bei der Ausgestaltung der Politik zu spielen.
Wie ihre zukünftige Selbstorganisation aussehen wird, ist eine offene Frage. Es kann angenommen werden, dass die traditionellen Nichtregierungsorganisationen altern und ihre Funktionalität einbüßen werden, ebenso wie die klassischen politischen Parteien. Sie werden jedoch offenkundig von neuen Formen abgelöst werden, und in diesen Formen wird sich gerade auch die neue Qualität der Beziehungen widerspiegeln. Natürlich nur, wenn die introvertierten Politiker in ihrem Bestreben, an dem überholten Modell festzuhalten, die gesunden Triebe nicht zugrunde richten.
Fjodor Lukjanow
ist Vorsitzender des Rats für Außen- und Verteidigungspolitik und Chefredakteur des Fachmagazins Russia in Global Affairs.